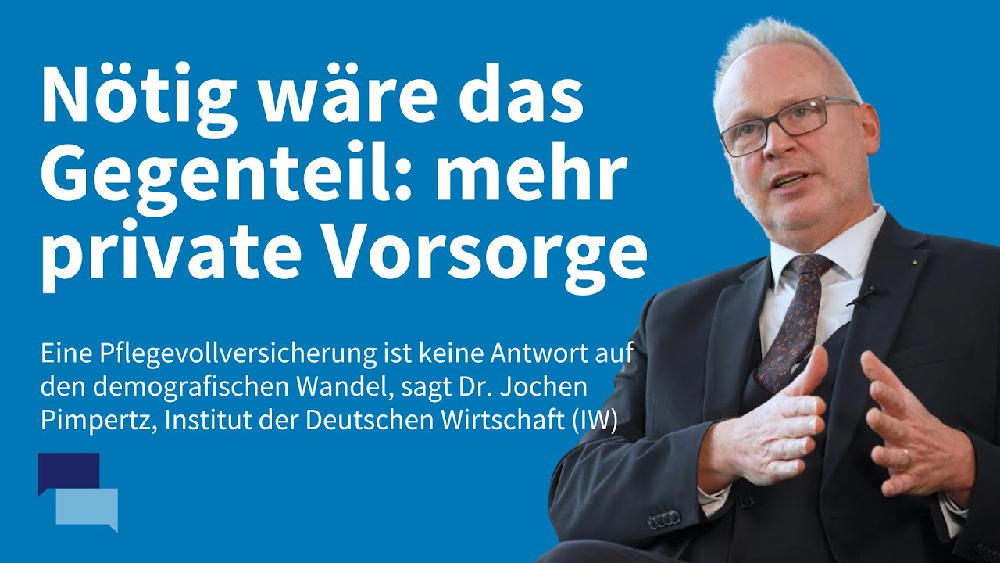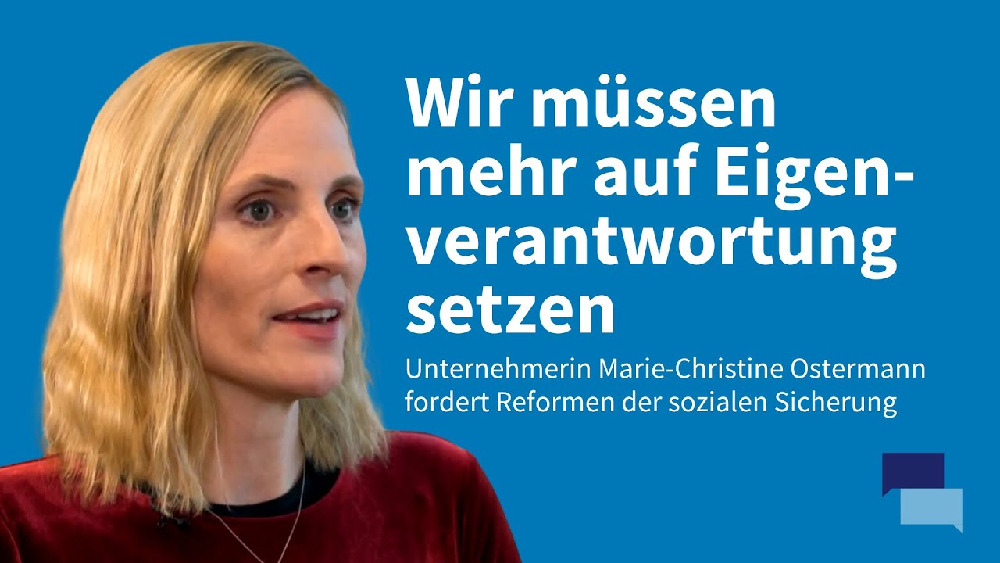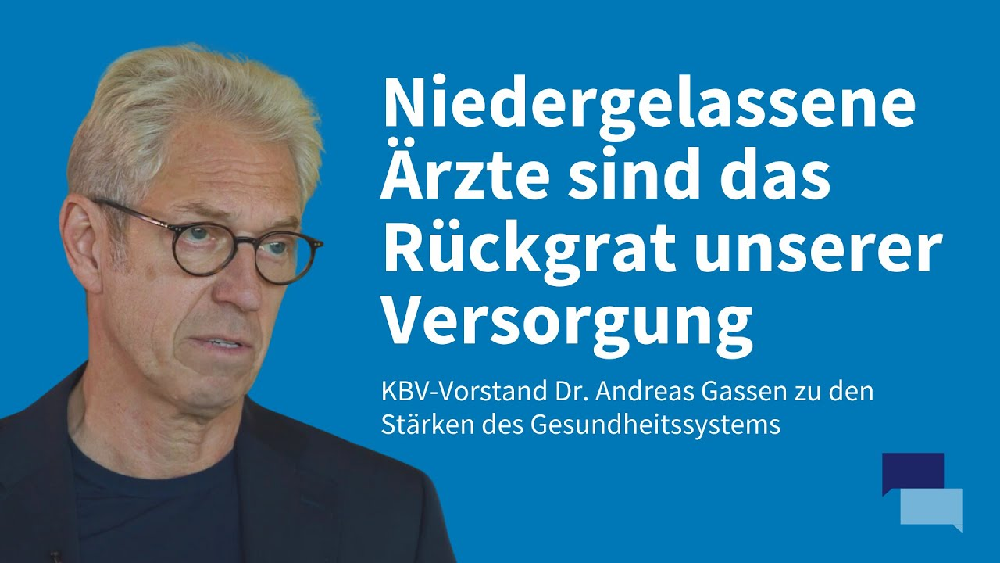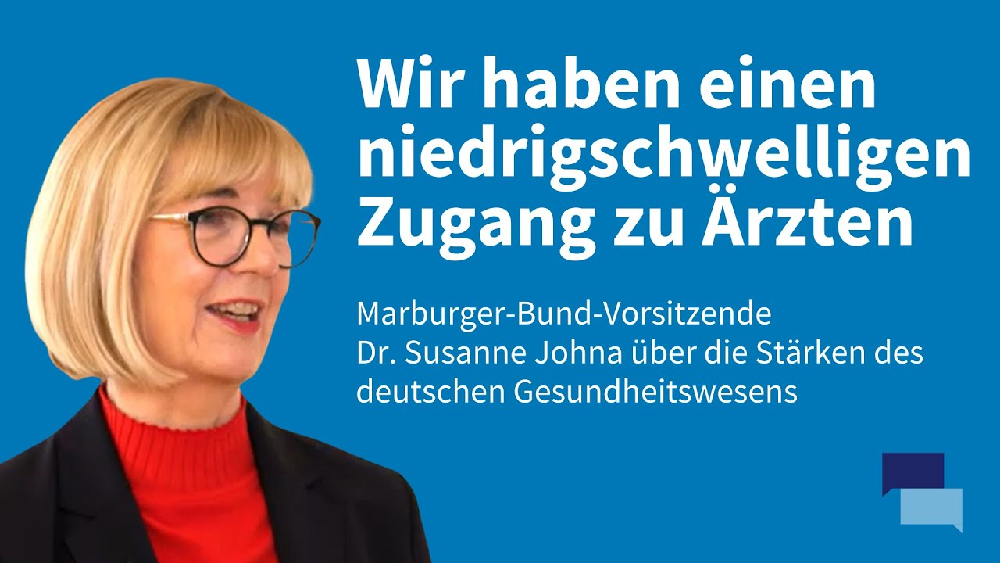Die Digitalisierung schreitet in vielen Lebensbereichen mit großem Tempo voran – und auch im Gesundheitswesen nutzen immer mehr Menschen komfortable und sichere digitale Angebote. Technische Basis für zentrale Gesundheitsanwendungen wie das E-Rezept und die elektronische Patientenakte (ePA) ist die Telematikinfrastruktur (TI), die Arztpraxen, Kliniken, Apotheken, Pflegeeinrichtungen und -dienste sowie Versicherte miteinander vernetzt. So können sensible Gesundheitsdaten sicher ausgetauscht werden. Um Zugang zur TI zu erhalten, benötigen Versicherte eine eindeutige Krankenversichertennummer: die Eintrittskarte für das digitale Gesundheitswesen. Nach vorheriger Information und Einwilligung beantragen die PKV-Unternehmen diese Nummer für ihre Versicherten.
Die PKV ist auch bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ein Motor für Innovation. Wir setzen auf anwenderfreundliche Technologien – denn nur, wenn Versicherte souverän über ihre Daten und Services entscheiden können, werden sie sich durchsetzen. So entlasten wir das gesamte Gesundheitssystem.
Versicherte steuern digitale Services
Ob individuelle Wahl von versicherten Leistungen und Tarifen oder freie Arztwahl – Privatversicherte entscheiden selbst, was oder wen sie in Anspruch nehmen möchten. Das gilt auch für digitale Services wie die ePA und das E-Rezept. Private Krankenversicherer bieten die Anwendungen auf freiwilliger Basis an – und Versicherte haben die Wahl, ob sie sie nutzen oder nicht. Auch hier setzt die PKV auf aktive Steuerung durch die Versicherten: Über die ePA-App können sie nicht nur ihre gespeicherten Gesundheitsdaten einsehen oder ergänzen, sondern den Gesundheitseinrichtungen auch individuellen Zugriff gewähren.
Wir entwickeln Lösungen von morgen
Kreditkarten, Mitgliedsausweise, Fahrscheine: Viele Chipkarten werden mittlerweile von entsprechenden Nachweisen auf dem Smartphone abgelöst. Das hat Vorteile: Einzelne Karten werden leicht vergessen, verloren, geklaut – das Smartphone hingegen haben fast alle Menschen immer dabei und passen besonders darauf auf. Deshalb setzt die PKV vom Start weg auf App-basierte Prozesse.
Die Europäische Union denkt übrigens in die gleiche Richtung: Mithilfe einer persönlichen digitalen Brieftasche – der sogenannten European Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet) – sollen sich EU-Bürgerinnen und -Bürger künftig mit dem Smartphone ausweisen sowie Identitätsdaten und amtliche Dokumente wie Personalausweis, Führerschein und Versicherungsnachweise speichern können. Dazu gehört z. B. auch die GesundheitsID als virtuelle Versicherungskarte. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, bis 2027 eine EUDI-Wallet bereitzustellen. Karten oder Lesegeräte werden der Vergangenheit angehören.
Füreinander da sein: mit praktikablen Vertreterregelungen
Smartphones sind durch alle Bevölkerungsgruppen hinweg weit verbreitet. Dennoch kann oder möchte nicht jede und jeder Versicherte alle verfügbaren digitalen Services nutzen. Das gilt vor allem für minderjährige und ältere Versicherte, aber z. B. auch für Menschen, die aufgrund von Krankheit vorübergehend nicht in der Lage dazu sind. Aus diesem Grund setzen wir uns für nutzerfreundliche Vertreterregelungen bei den TI-Anwendungen ein. Versicherte sollten komfortabel und rechtssicher Zugang etwa zu den elektronischen Patientenakten oder den E-Rezepten ihrer Angehörigen erhalten, um sie in ihren Gesundheitsbelangen zu unterstützen.
Gesetzlicher Rahmen für digitale Anwendungen
Als Mitgesellschafter der Digitalagentur gematik, die die Telematikinfrastruktur in Deutschland entwickelt, engagiert sich die PKV für ein zukunftsfähiges, sicheres digitalisiertes Gesundheitswesen. Damit die Anwendungen auch für Privatversicherte funktionieren, müssen einige Besonderheiten in der Entwicklung und bei ihrer Einführung bedacht werden. Zu unseren politischen Forderungen zählen daher:
- die obligatorische und zustimmungsfreie Anlage einer Krankenversichertennummer für alle Privatversicherten.
Derzeit muss die Krankenversichertennummer (KVNR) von PKV-Unternehmen für jede und jeden Versicherten individuell beantragt werden. Das verursacht ein hohes Maß an Bürokratie und kostet viel Zeit. Dabei gewinnt die KVNR immer mehr Bedeutung im digitalen Gesundheitswesen: Sie ist nicht nur Voraussetzung dafür, TI-Anwendungen wie die ePA und das E-Rezept zu nutzen. Sie wird z. B. auch für Meldungen an das Implantate- und das Krebsregister benötigt. Und Versicherte brauchen sie, um an medizinischen Modellvorhaben, etwa zur Genomsequenzierung, teilzunehmen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass die privaten Krankenversicherer – wie die gesetzlichen Krankenkassen auch – die Krankenversichertennummer künftig automatisiert und ohne explizite Zustimmung der Versicherten beantragen dürfen.
- sichere gesetzliche Rahmenbedingungen für PKV-Unternehmen, um TI-Anwendungen und Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in ihren Tarifbedingungen abzubilden.
Finanzielle Aufwendungen, die den PKV-Unternehmen für digitale Services entstehen, können bislang nicht rechtssicher als tarifliche Leistung gezahlt werden. Die strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die PKV bilden dies bislang nicht ab. Es ist der erklärte Wille des Gesetzgebers, digitale Schlüsseltechnologien allen Versicherten unabhängig von ihrem Versicherungsstatus zur Verfügung zu stellen. Daher fordern wir, dass es den PKV-Unternehmen ermöglicht wird, TI-Anwendungen wie ePA und E-Rezept, aber auch Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in ihren Tarifbedingungen abzubilden.
- die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, um privat krankenversicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) auszustellen.
Wir setzen uns dafür ein, dass geprüft wird, wie Arbeitgeber und Versicherungsunternehmen in den Prozess der eAU für Privatversicherte einbezogen werden können. Denn in der PKV gibt es – anders als in der GKV – keinen Datenaustausch zwischen Versicherung und Arbeitgeber. Im Sinne der Privatversicherten sollte hier ein sicherer, komfortabler und moderner Weg geschaffen werden.
Digitale Gesundheitsservices im Überblick
Die elektronische Patientenakte (ePA) bündelt zahlreiche medizinische Informationen und wichtige Dokumente der Nutzerinnen und Nutzer: zum Beispiel Berichte und Arztbriefe sowie eine Übersicht der regelmäßig eingenommenen Medikamente. Welche Daten in der ePA gespeichert werden sollen, entscheiden die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Sie können die Informationen in der App hochladen oder ihre Ärzte in der Praxis oder im Krankenhaus darum bitten und die Dokumente anschließend auf dem Smartphone oder Tablet verwalten. Die Akte für Privatversicherte wird nach denselben Spezifikationen wie jene für gesetzlich Versicherte gestaltet; die Nutzung ist grundsätzlich freiwillig.
(Zahn)-Ärztinnen und -Ärzte sowie Krankenhäuser sind verpflichtet, gesetzlich Krankenversicherten elektronische Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel auszustellen. Gegenüber privat krankenversicherten Patientinnen und Patienten gilt diese Pflicht nicht. Selbstverständlich können auch Privatversicherte das E-Rezept nutzen, wenn ihre Versicherung es ihnen anbietet. Hierzu steht ihnen die E-Rezept-App der gematik oder, wenn verfügbar, das E-Rezept-Modul in der ePA-App ihrer Versicherung zur Verfügung.
Alle Apotheken in Deutschland sollen mittlerweile E-Rezepte einlösen können. PKV-Versicherte können die Kostenbelege digital bei ihrer Krankenversicherung und ggf. der Beihilfe einreichen.
Mit der zunehmenden Digitalisierung werden neben konventionellen Sprechstunden immer mehr ärztliche Videosprechstunden genutzt. Die rechtliche Basis dafür wurde 2018 geschaffen, als das sogenannte Fernbehandlungsverbot bundesweit gelockert wurde. Bis dahin durften Ärzte keine Patienten online behandeln. Private Krankenversicherer erwiesen sich hier als Pioniere: Sie gehörten zu den Ersten, die Telemedizin für ihre Versicherten erstatteten. Seit 2022 gibt es durch eine gemeinsame Abrechnungsempfehlung mit der Bundespsychotherapeutenkammer und im Einvernehmen mit den Beihilfekostenträgern eine dauerhafte Grundlage für Videosprechstunden in der Psychotherapie. Auch ärztliche Videosprechstunden können Privatversicherte – abhängig vom individuellen Tarif – unbegrenzt in Anspruch nehmen. Grundlage sind die Abrechnungsempfehlungen zu telemedizinischen Leistungen von Bundesärztekammer, PKV-Verband und Beihilfe.
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) oder „Apps auf Rezept“ bezeichnen Smartphone-Anwendungen, die einen medizinischen Zweck erfüllen – also zum Beispiel Blutzuckerwerte kontrollieren, Schlafrhythmen analysieren oder psychologische Unterstützung anbieten. Sie können helfen, Krankheiten zu erkennen oder zu behandeln. Häufig ergänzen sie konventionelle Therapien beim niedergelassenen Arzt oder im Krankenhaus.
Anders als in der Gesetzlichen Krankenversicherung bedürfen DiGA in der PKV keiner Zulassung durch eine Bundesbehörde wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Versicherungsunternehmen erstatten tarifgemäß viele Apps, die eine Ärztin oder ein Arzt als medizinisch notwendig verschreibt. Voraussetzung ist, dass die DiGA als neue Leistung in einen Versicherungstarif einbezogen wurde und über die Zulassung als Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung verfügt. Zur individuellen Erstattung von Gesundheits-Apps informieren die privaten Krankenversicherer.
Seit dem Jahr 2022 sind digitale Pflegeanwendungen (kurz: DiPAs) als Leistungen der Sozialen und der Privaten Pflegepflichtversicherung aufgenommen – das regelt das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG). Digitale Pflegeanwendungen sind Apps und andere digitale Programme, die Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und Fachkräfte unterstützen, den Pflege-Alltag zu bewältigen. Mithilfe von körperlichen und geistigen Übungen können sie dazu beitragen, den Gesundheitszustand zu stabilisieren oder zu stärken oder auch die Kommunikation mit Angehörigen und Pflegefachkräften zu verbessern. Ähnlich wie bei den DiGAs in der Gesetzlichen Krankenversicherung sollen erstattungsfähige DiPAs in einem entsprechenden Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet werden.